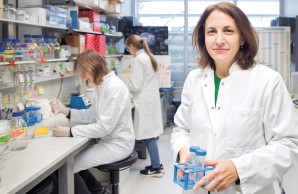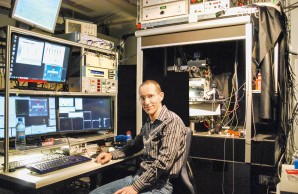Kurzbeiträge wissen + forschen 2018
Weitere Kurzbeiträge auf einen Blick finden Sie hier
-
Reha nach Hirninfarkt | IMPROVE: Innovative Versorgung von Schlaganfallpatienten
IMPROVE: Innovative Versorgung von Schlaganfallpatienten
Reha nach Hirninfarkt
Nach einem Schlaganfall erlangen nur 15 Prozent der Betroffenen eine vollständige Erholung der motorischen Funktionen. „Die allermeisten Patienten weisen auch Monate und Jahre nach dem Schlaganfall noch ausgeprägte Defizite vor allem in der Benutzung der Hand auf“, sagt Dr. Gunnar Birke, Klinik für Neurologie. Dies mache eine Rückkehr in den Beruf und häufig auch in das selbständige Leben nahezu unmöglich, so der Experte.
Marker für die Prognose des Rehaergebnisses
Um die Erkenntnisse über Neuroplastizität und die Mechanismen des Wiedererlernens von Funktionen nach einem Schlaganfall langfristig in neue Therapiemodelle in der Praxis umsetzen zu können, haben die Neurologen des UKE gemeinsam mit Rehabilitationskliniken in Hamburg, Bad Bramstedt, Damp, Soltau und Geesthacht eine interdisziplinäre Plattform für Rehabilitationsforschung und innovative Versorgung von Schlaganfallpatienten (IMPROVE) gegründet. „In einem ersten gemeinsamen Studienprojekt sollen die Haupteinflussfaktoren für ein gutes Rehabilitationsergebnis analysiert werden“, erläutert Dr. Birke. In weiteren Folgestudien sollen neurophysiologische und imagingbasierte Biomarker für die Prognose des Rehabilitationsergebnisses vor allem der Handfunktion sowie der Einfluss evidenzbasierter Patienteninformationen auf das Rehabilitationsergebnis untersucht werden. Dies soll langfristig die Basis bilden, um neue therapeutische Ansätze und Algorithmen für personalisierte Therapiepfade im klinischen Alltag der Rehabilitationskliniken zu etablieren.
-
Auf dem Weg zur individualisierten Neuro-Medizin | Personalisierte Therapiestrategien
Personalisierte Therapiestrategien
Auf dem Weg zur individualisierten Neuro-Medizin
Das Ausmaß der bei einem Schlaganfall entstandenen Defizite und die Fähigkeit zur Regeneration sind von Patient zu Patient verschieden. „Wir suchen Modelle, die für jeden einzelnen Patienten das für ihn passende Trainings- und Stimulationskonzept bestimmen können. So werden zum Beispiel Patienten mit erheblichen motorischen Defiziten untersucht, um den Einfluss schwerer neurologischer Symptome zu erforschen", erläutert Prof. Dr. Christian Gerloff, Ärztlicher Leiter der Klinik für Neurologie. „Inwieweit unsere bisherigen Erkenntnisse zu Veränderungen des Gehirns und seiner Netzwerke nach einem Schlaganfall auf diese Patientengruppe überhaupt übertragen werden können, ist noch unklar." Bisher verfügbare Modelle seien für schwer betroffene Patienten nicht gut geeignet, so Gerloff.
Der Schlaganfall – eine Netzwerkerkrankung
Die Neurologen gehen davon aus, dass es – abhängig vom Ausmaß des Gewebeschadens – einen kategorialen Unterschied zwischen initial schwer betroffenen Schlaganfallpatienten und Patienten mit moderaten und leichten Defiziten gibt. Diesen Unterschied genauer herauszuarbeiten, wird für die Weiterentwicklung individualisierter, patientenorientierter Therapiestrategien von großer Bedeutung sein. Prof. Gerloff: „Das bessere Verständnis des Schlaganfalls als eine Netzwerkerkrankung wird nicht nur zu neuen Erkenntnissen in der Erforschung von Reorganisationsprozessen beitragen, sondern auch helfen, nichtinvasive Hirnstimulationstechniken zur Verbesserung der Erholung weiterzuentwickeln."
-
Immunzellen bändigen – ein neuer Therapieansatz | Medikamente in der Entwicklung
Medikamente in der Entwicklung
Immunzellen bändigen – ein neuer Therapieansatz?
Die Forschungsgruppe „Experimentelle Schlaganfallforschung" von Prof. Dr. Tim Magnus, Klinik für Neurologie, versucht, neue Mechanismen für die Schlaganfallbehandlung zu entschlüsseln. „Wir konnten zeigen, dass absterbende Nervenzellen im Bereich des Schlaganfalles SOS-Signale in Form verschiedener Moleküle freisetzen – sogenannte Gefahrensignale oder ‚danger associated molecular patterns‘ ", erläutert Magnus. Diese locken Entzündungszellen an, aktivieren sie und setzen so eine zerstörerische Entzündungsreaktion im Gehirn in Gang. Das entstandene entzündliche Milieu führt zu weiterer Gewebeschädigung, die bis zu einem Drittel der endgültigen Schlaganfallgröße ausmacht. „Ziel ist es, die Entzündungsreaktion zu beeinflussen, um die auftretenden Hirnschäden zu reduzieren."
Nanobodies – eine neue Medikamentenklasse
In präklinischen Studien konnte so durch die Blockade entzündungsfördernder Schlüsselmoleküle wie Interleukin 17 oder Matrix-Metalloproteinasen das Schlaganfallwachstum reduziert werden – selbst wenn die Medikamente erst mehrere Stunden nach Beginn des Schlaganfalles appliziert wurden. Zum Einsatz kommt dabei eine neue Medikamentenklasse, die sogenannten Nanobodies, bei denen es sich um winzige Antikörper handelt, die sich gezielt an verschiedene Moleküle binden und diese blockieren können. Aufgrund eines günstigeren Nebenwirkungsprofils sind Nanobodies besser verträglich als herkömmliche Antikörper. Prof. Magnus: „Ziel weiterer Studien ist es, diese möglichen Medikamente bis zur klinischen Marktreife zu entwickeln."
-
Seltene Demenzen | Gehirnentwicklung als Krankheitsursache?
Gehirnentwicklung als Krankheitsursache?
Seltene Demenzen
Neben der Alzheimer-Demenz gibt es weitere, zum Teil sehr seltene Formen von Demenzen. Wissenschaftler des Instituts für Neuropathologie gehören zu den weltweit wenigen Forschern, die die familiäre Enzephalopathie mit Neuroserpin-Einschlüssen – auch Neuroserpin-Demenz genannt – erforschen. Bei dieser Demenz kommt es zu einer Verklumpung des Neuroserpins.
Was zum Untergang der Nervenzellen führt, ist nicht bekannt. Sowohl die Aggregation wie auch der resultierende Mangel des Proteins könnten verantwortlich sein. „Wir haben bereits wichtige Einsichten in den Zusammenhang der Entwicklung des Gehirns und des Neuroserpin-Proteins erlangt", sagt Dr. Giovanna Galliciotti, Arbeitsgruppenleiterin im Institut für Neuropathologie. „Mäusen, denen das Neuroserpin-Protein fehlt, entwickeln sich scheinbar normal und zeigen auch keine klaren Auffälligkeiten am Gehirn." Untersuche man die Tiere jedoch genauer, sehe man, dass sich das Gehirn nicht richtig entwickle und die Tiere Auffälligkeiten beim Lernen und beim sozialen Verhalten zeigten.
Ziel: Zelluntergang verlangsamen
„Unsere Erkenntnisse lassen es nun zu, gezielter daran zu forschen, wie man den Nervenzelluntergang bei der Neuroserpin-Demenz verlangsamen kann", so die Wissenschaftlerin. Gemeinsam mit dem Zentrum für Bioinformatik der Universität Hamburg wollen die Spezialisten nun mithilfe computerbasierter Modellierungsmethoden Wege finden, die Aggregation des Neuroserpin-Proteins zu verhindern.
-
Wie entsteht Bewusstsein? Wie wird es erforscht? | Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen
Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen
Wie entsteht Bewusstsein? Wie wird es erforscht?
Es ist eines der großen Rätsel der Neurobiologie: das menschliche Bewusstsein. Wie entsteht es? Was sind seine neuronalen Grundlagen? Antworten auf diese Fragen sucht auch Prof. Dr. Andreas K. Engel mit seiner Arbeitsgruppe am Institut für Neurophysiologie und Pathophysiologie. Und der Institutsdirektor ist zuversichtlich, dass es gelingt, „die Erklärungslücke zwischen dem Mentalen und dem Physischen noch erheblich zu verkleinern. Nach allem, was wir bisher wissen, liegt dem Bewusstsein nichts Ungreifbar-Metaphysisches zu Grunde." Vielmehr handele es sich um eine „Sammlung empirisch erforschbarer Phänomene", die sich im Bewusstsein des Menschen vereinen.
Viele Hirnregionen beteiligt
Soviel ist Hirnforscher Andreas Engel und seinem Team inzwischen über das Bewusstsein bekannt: „Es entsteht nicht in einem einzelnen Bereich des Gehirns, sondern durch das Zusammenwirken vieler verschiedener Hirnregionen." Eine zeitliche Übereinstimmung von Hirnwellen fördere offenbar die Kommunikation zwischen den beteiligten Hirnarealen und ermögliche die Informationsübertragung auch über weit entfernte Hirnbereiche hinweg, so der Professor. Die Synchronisation muss laut Andreas Engel aber spezifisch erfolgen und darf nicht zu stark sein: „Eine zu starke Kopplung hingegen blockiert offenbar die bewusste Verarbeitung von Reizen. So zeigen sich bei Probanden in Narkose im EEG abnorm starke und synchrone Hirnwellen. Diese sind im bewussten Wachzustand nicht vorhanden."
-
NCL: Krankheit verstehen, Therapien entwickeln | Weltweit anerkanntes Forschungszentrum
Weltweit anerkanntes Forschungszentrum
NCL: Krankheit verstehen, Therapien entwickeln
Als Hauptauslöser für eine Demenz im Kindesalter gelten Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen (NCL). Eine Heilung für die erblich bedingten Stoffwechselkrankheiten gibt es nicht. Im Rahmen des durch das Bundesforschungsministerium geförderten Konsortiums „NCL2TREAT" konzentrieren sich UKE-Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Braulke, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, auf die Erforschung der häufigsten NCL-Form CLN3. Ihr Ziel: im Labor die Krankheitsmechanismen zu verstehen und gezielt neue medikamentöse Therapieansätze zu entwickeln. In der zur Kinderklinik gehörenden NCL-Abteilung werden die vielversprechendsten Ansätze von Dr. Angela Schulz und ihrem Team durch Sammlung von Patientendaten ausgewertet. Die Abteilung ist Teil des Internationalen Zentrums für Lysosomale Erkrankungen (ICLD) des UKE – ein weltweit anerkanntes Behandlungszentrum für NCL-Patienten und von zentraler Bedeutung für den klinischen Teil aller „NCL2TREAT"-Projekte.
Defekte Müllabfuhr der Zelle
Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen zählen zur Gruppe der lysosomalen Speichererkrankungen. Erblich bedingte Genmutationen führen dazu, dass die Lysosomen – die Müllschlucker einer Zelle – fehlerhaft arbeiten und die molekularen Abfälle des Zellstoffwechsels nicht abgebaut werden können. In der Folge sterben gesunde Nervenzellen. Bislang wurden 13 Gene entdeckt, die zu den häufigeren Formen führen. Typisch für NCL sind Symptome wie Demenz, Verlust der Sehfähigkeit, epileptische Krampfanfälle und der Verlust motorischer Fähigkeiten.
-
Gedanken sichtbar machen | Neue Methode der Optogenetik
Neue Methode der Optogenetik
Gedanken sichtbar machen
Die Entdeckung von lichtgesteuerten Ionenkanälen im Jahr 2002 war die Geburtsstunde der Optogenetik. Erstmals waren Neurobiologen in der Lage, bestimmte Gruppen von Nervenzellen gezielt durch Licht anzuschalten. Prof. Dr. Thomas Oertner, Direktor des Instituts für Synaptische Physiologie am Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH), nutzt heute mit seiner Arbeitsgruppe die Optogenetik zur Entwicklung neuer Methoden der Hirnforschung. Die Wissenschaftler wollen aktive Synapsen im Hirngewebe sichtbar machen. „Aus technischer Sicht ist das Hauptproblem, dass die Aktivität nur wenige Millisekunden anhält. Diese Signale sind zu kurz, um sie mit Laser-Scanning- Mikroskopie in einem großen Volumen lokalisieren zu können", erklärt der Hirnforscher. Durch ein schaltbares Fluoreszenzprotein könne man nun aber mit UV-Licht den Aktivitätszustand tausender Synapsen gleichsam „einfrieren" und dann in aller Ruhe die Position aller aktiven und inaktiven Synapsen im lebenden Hirngewebe kartographieren. „Gedächtnisprozesse sichtbar zu machen ist ein alter Traum der Hirnforschung", so Thomas Oertner.
Aus-Schalter für Nervenzellen
Bereits 2014 konnte die Arbeitsgruppe aus dem ZMNH um Thomas Oertner zusammen mit weiteren Partnern der Humboldt-Universität Berlin einen lichtgesteuerten Ionenkanal entwickeln, der die Aktivität von Nervenzellen unterdrückt. Den Hirnforschern steht seitdem neben dem 2002 entdeckten An-Schalter auch ein Aus-Schalter für Nervenzellen zur Verfügung.
-
Synapsen im Fokus | Wie Nervenzellen kommunizieren
Wie Nervenzellen kommunizieren
Synapsen im Fokus der ZMNH-Forscher
Nervenzellen kommunizieren miteinander über spezielle Kontaktstellen: die Synapsen. Unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Kneussel vom Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg erforschen Wissenschaftler in einer seit 2016 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschergruppe die molekularen Mechanismen an den Synapsen. Ihr Ziel: grundsätzliche Prinzipien der molekularen Mechanismen von synaptischer Plastizität und Stabilität zu erarbeiten.
Schnelle Veränderungen im Blickpunkt
Im Fokus der Forscher stehen deshalb die durch unterschiedliche Aktivitäten hervorgerufenen schnellen Veränderungen an den Synapsen. „Die Mehrzahl der molekularen Komponenten einer Synapse ist hoch dynamisch und die meisten Moleküle werden nur kurzzeitig angeliefert und danach schnell wieder umgelagert oder abgebaut", erklärt Matthias Kneussel. Die zentrale Frage sei, wie ein solch dynamisches System stabile neuronale Verschaltungen gewährleisten könne und an langfristigen Gedächtnisprozessen beteiligt sei. Dazu wollen die Forscher untersuchen, wie sich Synapsen in komplexen neuronalen Schaltkreisen des Gehirns verändern und so kognitive Leistungen wie Lernen und Erinnern ermöglichen. Die Erforschung der Synapsen kann dazu beitragen, neue Therapieansätze für Demenzen und Synaptopathien zu entwickeln. Synaptopathien sind Erkrankungen, denen eine Störung der Kommunikation zwischen Nervenzellen zugrunde liegt – wie beispielsweise Schizophrenie, Epilepsie und Autismus.
-
Wer dirigiert das Nervenzellen-Orchester? | Zusammenarbeit unterschiedlicher Hirnregionen
Zusammenarbeit unterschiedlicher Hirnregionen
Wer dirigiert das Nervenzell-Orchester?
Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken, Riechen: Um ein einheitliches Bild von der Umwelt zu erhalten und es dauerhaft in unseren Erinnerungen und Erfahrungen einzubauen, müssen die verschiedenen, weit entfernt voneinander liegenden Bereiche des Gehirns, die für die Verarbeitung unterschiedlicher Umweltreize zuständig sind, koordiniert werden. Wie geschieht das? Prof. Dr. Ileana Hanganu-Opatz, Leiterin der Arbeitsgruppe Entwicklungsneurophysiologie im Institut für Neuroanatomie, geht dieser Frage mit ihrer Arbeitsgruppe im ZMNH nach. Das Team erforscht unter anderem, wie die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnarealen reift. „Koordinierte elektrische Aktivität zahlreicher Nervenzellen spielt hierbei eine wichtige Rolle", erklärt die Forscherin. „Es wird angenommen, dass die resultierenden Schwingungen, die Hirnrhythmen, nicht nur ein Abbild unserer Wahrnehmung der Umwelt sind, sondern auch zur Hirnentwicklung, zur Informationsverarbeitung und zum Verhalten beitragen."
Veränderte Hirnrhythmen und Schizophrenie
Die Studien der UKE-Wissenschaftler über die Rolle der Hirnrythmen während der Entwicklung sind deshalb nicht ausschließlich Grundlagenforschung: Ileana Hanganu-Opatz und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen auf diese Weise den Ursachen neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen näherkommen. „Die gestörte Konnektivität zwischen Hirnarealen und die damit einhergehende Veränderung der rhythmischen Aktivität ist ein Merkmal vieler psychiatrischer Krankheiten, wie zum Beispiel der Schizophrenie", so die Forscherin.
-
Unheilvolle Kombination | Sucht als Ursache und Folge früher Gewalt
Sucht als Ursache und Folge früher Gewalt
Unheilvolle Kombination
Suchterkrankungen sind häufig eine Folge von Gewalt und Vernachlässigung in der Kindheit; bis zu zwei Drittel aller Patienten in der Suchtbehandlung haben frühe Misshandlung und Vernachlässigung erlebt, erläutert Prof. Dr. Ingo Schäfer, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Seine Arbeitsgruppe „Trauma- und Stressforschung" koordiniert den Forschungsverbund CANSAS („Childhood Abuse and Neglect as a cause and consequence of Substance Abuse – understanding risks and improving Services"), der Zusammenhänge zwischen Substanzmissbrauch und früher Gewalt entschlüsseln will. Aktuelle Forschungsbefunde legen laut Prof. Schäfer nahe, dass psychologische und biologische Faktoren, die an der Regulation von Stress und Emotionen beteiligt sind, für den Zusammenhang zwischen früher Gewalt und der späteren Entwicklung von Suchtproblemen von zentraler Bedeutung sind. Umgekehrt sind Störungen der Emotionsregulation ein wichtiger Risikofaktor für die Ausübung von Gewalt durch suchtkranke Eltern.
Behandlungsansätze auf Wirksamkeit überprüfen
Im multizentrischen CANSAS-Netzwerk wurden die Bereiche Prävention, Therapie, Epidemiologie, Grundlagen- und Versorgungsforschung interdisziplinär behandelt. Prof. Schäfer: „Wir wollen unter anderem spezielle Behandlungsansätze für Betroffene auf ihre Wirksamkeit überprüfen und Hilfseinrichtungen darin unterstützen, das Risiko von Eltern mit Suchtproblemen, Gewalt gegen ihre Kinder auszuüben, besser einzuschätzen."
-
Prionen: Prototypen für Alzheimer und Parkinson | Unaufhaltsame Zerstörung des Gehirns
Unaufhaltsame Zerstörung des Gehirns
Prionen: Prototypen für Alzheimer und Parkinson
Bei den Prionenerkrankungen, zu denen sowohl BSE als auch die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gehören, handelt es sich um stets tödlich verlaufende Erkrankungen bei Menschen und anderen Säugetieren, in deren Verlauf schrittweise und bislang unaufhaltsam das Gehirn zerstört wird. Prinzipiell sind sie auch zwischen Individuen und manchmal sogar – wie im Falle des BSE-Erregers – zwischen Arten übertragbar. „Damit zählen die Prionenerkrankungen einerseits zu den Infektionskrankheiten, andererseits bezüglich ihrer pathologischen Vorgänge und ihrer Klinik aber auch zu den neurodegenerativen Erkrankungen", sagt Dr. Hermann Altmeppen aus dem Institut für Neuropathologie.
Falsch gefaltete Eiweiße verlieren Funktion
So wenig jedoch die Verursacher von Prionenerkrankungen, die sogenannten Prionen, mit klassischen Infektionserregern wie Viren, Bakterien oder Parasiten gemein haben, so ähnlich sind die von ihnen verursachten Leiden anderen, weitaus häufigeren neurodegenerativen Erkrankungen. Altmeppen: „Tatsächlich kann man Prionenerkrankungen als eine Art Prototyp für viele meist altersbedingte und Demenz verursachende Krankheiten wie beispielsweise die Alzheimersche Erkrankung oder Morbus Parkinson ansehen." Bei diesen Erkrankungen kommt es zu Fehlfaltungen von Proteinen im Gehirn; falsch gefaltete Proteine verlieren ihre Funktionen. „Zudem verklumpen sich fehlgefaltete Proteine zu großen Ablagerungen im Gehirn. Dabei kommt es zu einem fortschreitenden Untergang von Nervenzellen und zum Verlust wichtiger Hirnfunktionen."
-
Welche Therapie für welchen Patienten? | RECOVER: Projekt zur Versorgungsforschung
RECOVER: Projekt zur Versorgungsforschung
Welche Therapie für welchen Patienten?
Nehmen psychische Störungen zu? Macht uns Arbeit krank? Brauchen wir mehr psychologische und psychiatrische Behandlung? Fragen, die Ärzte, Patienten und die Gesellschaft insgesamt bewegen. „Fakt ist, dass viele Patienten monatelang auf eine ambulante Psychotherapie warten müssen", sagt Prof. Dr. Jürgen Gallinat, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. RECOVER heißt ein neues, von Prof. Dr. Martin Lambert koordiniertes Forschungsprojekt, das vom Innovationfonds mit 6,8 Millionen Euro gefördert wird. Dabei handelt es sich um ein Modell der sektorenübergreifend-koordinierten, schweregradgestuften, evidenzbasierten Versorgung psychisch Erkrankter – bezogen auf die großstädtische Region Hamburg und die ländlich-kleinstädtische Region Steinburg mit der Kreisstadt Itzehoe.
Steuerung von Behandlungsressourcen
„Das wesentliche Element des Projekts ist die Steuerung von Behandlungsressourcen", erläutert Prof. Gallinat. Patienten mit schweren psychischen Störungen erhalten die intensivste Behandlung, Patienten mit leichten psychischen Störungen oder keiner psychiatrischen Diagnose erhalten unkomplizierte Beratung und Unterstützung. Die hier frei werdenden Ressourcen werden anderen Patienten zugeordnet und gezielter eingesetzt. „Die Intensität der Behandlung ist stark am Schweregrad der Erkrankung orientiert. Darüber hinaus gibt es keine unkritische Ausweitung von Leistungen", so Gallinat. – RECOVER wird von vier großen Krankenkassen getragen und hat eine Laufzeit von drei Jahren.